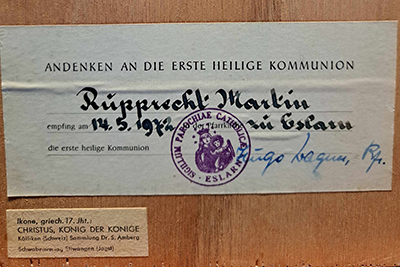In Österreich ist Pfingsten neben Weihnachten und Ostern ein Hochfest, das wir mit zwei Feiertagen begehen. Doch selbst vielen Christen ist nicht klar, was man zu Pfingsten feiert. Dabei ist Pfingsten ein wichtiges Fest, denn es gilt als „Geburtsstunde der Kirche“.
Das Pfingstfest wird am 50. Tag nach Ostern gefeiert. Aus diesem Datum leitet sich auch der Name ab, denn das Wort Pfingsten stammt vom altgriechischen Wort „pentekoste“ (übersetzt: der Fünfzigste, also: der 50. Tag). Der Feiertag ist also an den Ostertermin gekoppelt und kann daher zwischen dem 10. Mai und dem 13. Juni liegen. Nicht nur durch Datum und Namen gibt es eine Verbindung zu Ostern, sondern auch religiös.
Die Ursprünge von Pfingsten
Als christliches Fest wird Pfingsten bereits im Jahr 130 erwähnt. Die Ursprünge reichen jedoch viel weiter zurück, denn das Fest folgt einer langen jüdischen Tradition. Sieben Wochen nach dem Paschafest feiert man im Judentum Schawuot, das Wochenfest. Es ist ursprünglich ein Erntedankfest, denn es markiert das Ende der Weizenernte. Während das Paschafest an den Auszug aus Ägypten erinnert, entwickelte sich das Wochenfest als Erntedankfest im Laufe der Zeit zu einem Dankfest für die Verkündigung der Tora, der fünf Bücher des Mose. Die Tora ist die Basis des jüdischen Glaubens.
Der Pfingsttag in der Bibel
Dieses Wochenfest Schawuot ist es, das im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte in der Bibel als „Pfingsttag“ erwähnt wird. Als alle Jünger in einem Haus versammelt sind, zieht vom Himmel her ein Brausen auf, das das Gebäude erfüllt. „Zungen wie von Feuer“ kommen auf sie herab. „Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab …“
Petrus erhebt sich und wendet sich an die Menschen, die herbeigeeilt sind und die Jünger umgeben. Er erklärt ihnen, dass sich das Wort des Propheten Joel erfüllt habe. Dort heißt es, dass Gott seinen Geist über alle ausgießen werde und er Wunder erscheinen lasse am Himmel und Zeichen auf der Erde, nämlich Blut, Feuer und qualmenden Rauch (Joel 3).
Nach dieser Predigt von Petrus sind die Zuhörer sehr berührt. Er lädt sie ein, umzukehren und sich zur Vergebung der Sünden auf den Namen Jesu Christi taufen zu lassen. Die Bibel berichtet, dass sich noch an diesem Tag etwa dreitausend Menschen taufen ließen.
Die Geburtsstunde der Kirche
Wegen dieser Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag wird dieses Ereignis als Geburtstag der Kirche und als Beginn der weltweiten Mission verstanden. Vor allem die Fähigkeit der Jünger, in fremden Sprachen zu sprechen und sie zu verstehen, wird theologisch als Mission der Kirche gedeutet. Alle Menschen werden angesprochen, egal welcher Volksgruppe oder Nationalität sie angehören. Der Heilige Geist ist also nicht mehr Propheten oder anderen ausgewählten Menschen vorbehalten, sondern er kommt herab auf alle Menschen.
Die Getauften bilden eine Gemeinschaft, die alles teilt und am Brechen des Brotes und an Gebeten festhält. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, fühlen sich als Einheit im Glauben an Jesus Christus und Gott Vater. Durch Pfingsten wird die Dreifaltigkeit Gottes für den Menschen offenbart.
Darauf besinnen wir uns bei jeder Taufe: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Oder auch beim Kreuzzeichen: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Ohne das Pfingstwunder, wovon uns die Bibel berichtet, und die Aussendung des Heiligen Geistes wäre der christliche Glaube nicht komplett und nicht wirkungsvoll.
Taube und Feuerzungen als Bilder
In den künstlerischen Darstellungen der Herabkunft des Heiligen Geistes gibt es zum einen die erwähnten Feuerzungen, aber auch die Taube ist ein beliebtes Bild. Sie wird im Lukasevangelium ausdrücklich erwähnt, bei der Taufe Jesu: „Und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden“ (Lk 3,22). In der Antike war die Taube das Sinnbild für Sanftmut und Unschuld. Die Menschen nahmen an, dass die Taube keine Galle besitze und dadurch frei von allem Bösen und Bitteren sei. Später wurde der Heilige Geist auch als Mensch dargestellt, doch diese Art der Darstellung wurde von Papst Urban VII. im 17. Jahrhundert untersagt.
Das Pfingstfest ist nicht nur das Hochfest, an dem das Kommen des Heiligen Geistes gefeiert wird, sondern es ist auch gleichzeitig der Abschluss der Osterzeit. In den neun Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten wird in der sogenannten Pfingstnovene um das Kommen des Heiligen Geistes gebetet. Auch dazu gibt es einen biblischen Bezug: In Apg 1,12ff wird berichtet, dass die Jünger Jesu mit Maria, der Mutter Jesu, und anderen Mitgliedern der christlichen Urgemeinde nach der Himmelfahrt Jesu nach Jerusalem gingen, um dort im Gebet zu verharren.
(Quelle: Kirche in Not. Bearbeitet v. Pfr. M. Rupprecht)


 Die Frage nach dem Raum stellte Dr. Christoph Benke ins Zentrum seiner Predigt zu Fronleichnam (30.05.2024) in Schönbrunn Vorpark; den Raum für das Abendmahl und das Pfingstereignis, aber auch den Raum, den Jesus bei uns findet.
Die Frage nach dem Raum stellte Dr. Christoph Benke ins Zentrum seiner Predigt zu Fronleichnam (30.05.2024) in Schönbrunn Vorpark; den Raum für das Abendmahl und das Pfingstereignis, aber auch den Raum, den Jesus bei uns findet. Warum ist Jesus nach seiner Auferstehung nicht einfach auf der Erde bei seinen Jüngern geblieben? Das wäre bestimmt möglich gewesen. Doch dann hätte er uns Menschen eine wichtige Sache vorenthalten: Nämlich die Ankunft des Heiligen Geistes.
Warum ist Jesus nach seiner Auferstehung nicht einfach auf der Erde bei seinen Jüngern geblieben? Das wäre bestimmt möglich gewesen. Doch dann hätte er uns Menschen eine wichtige Sache vorenthalten: Nämlich die Ankunft des Heiligen Geistes.