Christentum meint Einheit – aber in lebendiger Verschiedenheit – Predigt
 Über den sozialen Sprengstoff, der in den Anfängen der christlichen Botschaft liegt, und das, was heute daraus folgt im Zusammenhang mit der Aufforderung zum Einssein, predigt Dr. Johann Pock am 12. Sonntag im Jahreskreis (22.06.2025) in Schönbrunn-Vorpark.
Über den sozialen Sprengstoff, der in den Anfängen der christlichen Botschaft liegt, und das, was heute daraus folgt im Zusammenhang mit der Aufforderung zum Einssein, predigt Dr. Johann Pock am 12. Sonntag im Jahreskreis (22.06.2025) in Schönbrunn-Vorpark.
Paulus war ein Revolutionär! Was er seinen Mitmenschen zumutete, war für manche damals ungeheuerlich. Und der eine Vers in seinem Brief an die Galater, den wir gehört haben, birgt auch heute noch Zündstoff – und es passt auch sehr gut zum gerade begangenen „Weltflüchtlingstag“ am 20. Juni:
Gal 3,28 „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid „einer“ in Christus Jesus“.
Und Paulus sagt das nicht als Wunsch an die Zukunft; oder als Absichtserklärung – sondern als Tatsache, wenn man an Christus glaubt.
In den damaligen Ohren war das undenkbar: Juden und Heiden sollten eins sein? Mann und Frau auf gleicher Stufe? Sklaven und Freie in einem Atemzug genannt? Manche damals werden sich gedacht haben: Das wäre ja noch schöner, wenn das so wäre; dann bricht die Gesellschaft zusammen, wenn es nicht mehr Herren und Sklaven gibt; oder wenn Frauen in öffentlichen Versammlungen reden. Und solche Texte finden wir als Widerhall der damaligen Gesellschaft auch in der ganzen Bibel.
Die christliche Botschaft hatte von Anfang an jedenfalls sozialen Sprengstoff in sich: Jesus wendet sich gegen die Überordnung von Herren und Dienern. „Wer der erste sein will, soll der Diener aller sein“. Wer vorangehen will, der soll den Seinen auch die Füße waschen – d.h. sich nicht zu schade sein, auch die einfachen Arbeiten zu verrichten.
Ein neues Verhältnis von Mann und Frau – auf Augenhöhe
Aber auch im Blick auf das Verhältnis von Mann und Frau war das Christentum damals fortschrittlich – so sehr, dass manche sich davor fürchteten, als radikale Sekte gesellschaftlich abgelehnt zu werden.
Heute denkt man bei römisch-katholischer Kirche eher daran, was Frauen bzw. was Laien alles nicht dürfen; oder noch nicht dürfen. Doch in der damaligen Zeit hat Jesus hier Grenzen überschritten: Frauen waren in seinem Gefolge. Es gab zur Zeit des Apostels Paulus auch Frauen als Apostel. Die ersten Zeuginnen der Auferstehung waren die drei Frauen am Grab. … Also eine Fülle von Beispielen, die zeigen, dass in den Ursprüngen der Christenheit nicht mehr zählte „Mann oder Frau“, sondern: Zeuge für Christus oder nicht.
Offenheit für andere Religionen und andere Kulturen
Und auch im Blick auf die religiöse Herkunft werden Grenzen überschritten: Nicht mehr Juden und Griechen. Das Christentum überschreitet die Grenzen seiner Herkunft, des jüdischen Glaubens – und tritt in Dialog mit den Griechen, also mit Heiden. Es werden nun auch Menschen getauft, ohne zuvor jüdisch werden zu müssen.
Es erinnert auch an die Texte von Pfingsten: Durch den Heiligen Geist kommt ein Verständnis zustande über alle Sprachen und Nationen hinweg.
Einssein in Christus
Und das wichtigste Wort für Paulus lautet dabei: „Sie alle sind einer in Christus“ – und zwar durch die Taufe. Wer getauft ist, unterscheidet nicht mehr zwischen sozialen Herkünften oder religiösen Ausrichtungen. Paulus versucht den Blick nicht auf das Trennende zu richten, sondern auf das, was verbindet.
Im Johannesevangelium ist viel die Rede von diesem „Eins-Sein“. Und häufig wird damit jegliche andere Meinung, jegliches Abweichen von offiziellen Lehrmeinungen verurteilt. Dabei geht es meines Erachtens genau um das Gegenteil: Mit all unseren Unterschieden; mit unseren verschiedenen Einstellungen und Erfahrungen, sind wir als Getaufte trotzdem eins. Wir sind eins – egal ob Mann oder Frau, Kind oder Erwachsener, jung oder älter, egal ob Arbeiter, Angestellter, Selbständiger, Lehrer oder Schüler …: Vor Christus sind wir eins – und dürfen trotzdem wir selbst bleiben mit unseren Unterschieden.
Einssein – das bedeutet eben nicht ein Aufheben der Unterschiede; ein Nivellieren; das wäre dann doch ziemlich fad. Sondern es bedeutet, dass die Unterschiede nicht trennend sein müssen, dass Vielfalt die Einheit nicht bedroht.
Und es ist dies eine Einheit, die uns verbindet mit den Urahnen – und Paulus nennt da z.B. Abraham und seine Nachkommen. Als Christinnen und Christen sind wir eins mit ihnen – und das heißt wohl auch: wir sind genauso Nachkommen Abrahams wie das jüdische Volk oder die Muslime.
Und wir sind eins mit den Menschen, die noch kommen werden. Gerade in der Messe schwingen wir im Gebet ein in diese Tradition vor uns und nach uns; wir hören Texte aus der Geschichte – und wir bitten für unsere Zukunft.
Wenn heute mit dem Christentum oft eher die Gebote und Verbote verbunden werden; oder die Macht, die sich an den Gebäuden und Strukturen zeigt – dann tut es gut, an diese Ursprünge zu erinnern: All das Äußere steht im Dienst dieses Jesus und seiner frohen Botschaft.
Feiern wir diese Einheit in der Verschiedenheit – und tun wir alles dafür, dass Unterschiede als Reichtum, nicht als Bedrohung wahrgenommen werden.

 Alexa auf Pixabay
Alexa auf Pixabay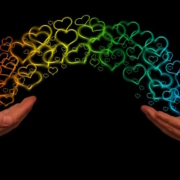 www.pixabay.com
www.pixabay.com Sonja-Kalee | Pixabay
Sonja-Kalee | Pixabay www.pixabay.com
www.pixabay.com www.pixabay.com
www.pixabay.com www.pixabay.com
www.pixabay.com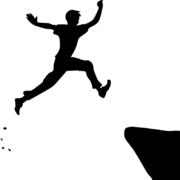 www.pixabay.com
www.pixabay.com  Reginal auf Pixabay
Reginal auf Pixabay Pfarre Hildegard Burjan | Norbert Potensky
Pfarre Hildegard Burjan | Norbert Potensky