Leuchtende oder matt gewordene Steine
 Delegat Dr. Nikolaus Krasa führte in seiner Predigt in Schönbrunn-Vorpark am Gründonnerstag (17.04.2025) seine Überlegungen zu den Steinen weiter und setzte sie in Bezug zu den Geschehnissen beim Abendmahl.
Delegat Dr. Nikolaus Krasa führte in seiner Predigt in Schönbrunn-Vorpark am Gründonnerstag (17.04.2025) seine Überlegungen zu den Steinen weiter und setzte sie in Bezug zu den Geschehnissen beim Abendmahl.
Mir geht das Bild der bunten Steine, das uns thematisch durch den Palmsonntag begleitet hat, immer noch nach. Nicht deshalb, weil ich beim Spiel mit den Steinen (Petra hat davon erzählt) am Aschermittwoch kläglich versagt habe. Das ist schon gut, wenn man seine eigenen guten Taten so tut, dass sie nur der Vater im Himmel sieht. Das Bild geht mir nach auf dem Hintergrund des großen dramatischen Bogens, mit dem uns der Palmsonntag in die Karwoche hineingeführt hat, den wir bewusst mitgegangen sind. Sie erinnern sich: Die, die Jesus zujubeln, die vor ihm Kleider ausgebreitet haben (damals noch kein Wegwerfprodukt), sind die, die wenig später „Ans Kreuz mit ihm“ und „Nicht diesen, sondern Barabbas“ gerufen haben. Aus bunten Steinen werden harte Steine. Das ist, was uns Menschen auszeichnet: Wir können beides, mit Steinen werfen und schöne Steine gestalten. Dieselbe Zunge, mit der wir sagen: ‚Ich liebe dich.‘ kann genauso leicht sagen: ‚Ich hasse dich.‘, dieselbe Hand, die wir jemand zur Hilfe entgegenstrecken, kann jemanden verletzten.
Das als Botschaft am Ende der Fastenzeit (besser der vorösterlichen Bußzeit), in der wir uns doch bemüht haben, bessere Menschen zu werden, verschiedene Fastenvorsätze gefasst haben, uns echt angestrengt haben. Wäre da nicht eher ein Evangelium angebracht, an dem uns Jesus sozusagen auf die Schulter klopft und sagt: ‚Gut habt ihr das in den letzten 40 Tagen gemacht, jetzt dürft ihr Auferstehung feiern‘?
Mir ist bei unserer dramatisierten Passionsdarstellung etwas noch deutlicher geworden als sonst. Am Beginn waren Jünger bei mir, haben mich in die Kirche hineinbegleitet, dann waren nur mehr Judas und die römischen Soldaten da, von den Jüngern keine Spur. Und das am Ende eines dreijährigen Weges mit Jesus, an dem sie sich bemüht haben, als Schüler (das heißt das griechische Wort mathetes, das üblicherweise mit Jünger übersetzt wird, eigentlich), also als Schüler etwas von Jesus zu lernen. Dort, wo der Weg Jesu ans Ziel kommt, sind sie nicht mehr mit dabei, schaffen sie es nicht mehr mitzugehen. Im heutigen Evangelium, das noch im Abendmahlssaal, also vor der Ölbergszene spielt, wird das bereits zum Thema: Unmittelbar danach wird Judas den Abendmahlssaal verlassen, um Jesus zu verkaufen, danach Petrus von Jesus darauf hingewiesen werden, dass er ihn verleumden wird. Letztlich wird also keiner der Jünger, denen Jesus die Füße wäscht, es bis ans Kreuz schaffen, außer (das aber nur bei Johannes) der Jünger, den Jesus liebte. Die bunten Steine, die die Jünger vielleicht auf ihrem Weg mit Jesus angesammelt haben, werden im schlimmsten Fall zu Steinen, die sie nach ihm werfen, im besseren vergilben sie einfach, werden stumpf, leuchten nicht mehr…
Wie geht Jesus damit um? Keine Kritik, auch an Judas und Petrus nicht, nur eine Feststellung der Tatsachen. Keine Zurechtweisung der Jünger. Sondern jener bekannte Gestus, den wir bald hier wiederholen werden, weil es offenbar am Gründonnerstag so wichtig ist, ihn leibhaft vor Augen zu haben. Er erhebt sich nicht über die Jünger und schimpft sie zusammen, er bückt sich und macht sich kleiner als sie, er wäscht ihnen nicht den Kopf, er wäscht ihnen die Füße. Er tut ihnen etwas Gutes. Um bei unserem Bild zu blieben: Er sagt nicht: ‚Putzt eure Steine, oder legt die Steine, die ihr werfen wollt, weg.‘ Er selbst putzt die Steine, dass sie wieder leuchten, umfasst liebevoll die Hand, die im übertragenen Sinn bereit ist, den Stein zu werfen.
Was das heißt, bedeutet und wie das wirkt, wird erst nach Ostern, eigentlich in jeder Ostergeschichte, deutlich. Ich greife nur eine heraus. Ganz am Ende des Johannesevangeliums, die Erscheinung des Auferstanden am Nachmittag des Ostertages, scheint nicht gereicht zu haben. Die Jünger sind zu ihren Ursprungsberufen zurückgekehrt, sie tun das, wobei wir sie am Beginn des Evangeliums kennengelernt haben. Sie fischen. Und sind erfolglos. Und nach einer mühevollen Nacht, als sie ans Land zurückrudern, sehen sie ein Feuer, Jesus daneben, der ihnen ein Frühstück zubereitet hat. Brot und Fische. Und plötzlich ist da in Petrus die Begeisterung des Anfangs wieder da, er springt aus dem Boot und auf Jesus zu. Und da am Seeufer, am selben See, in dessen Umland Petrus Jesus kennengelernt hat, fragt Jesus den Petrus: ‚Liebst du mich?‘ Also wieder keine Moralpredigt, kein Hinweis auf den trüb gewordenen Stein, sondern das Zutrauen, dass da noch etwas ist von der ersten Liebe. Trotz alldem – Jesus fragt nicht naiv, bewusst dreimal ist die Frage gestellt, entsprechend der Zahl der Verleumdungen. Und jetzt kann Petrus sagen: ‚Du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe.‘ Und der Stein strahlt und leuchtet wieder.
Was lässt mich leben, steht auf unserem Fastentuch, das wir noch bis morgen sehen werden. Was lässt mich leben, genau dieses Verhalten Jesu, vielleicht müsste man sogar eher sagen, wer lässt mich leben?

 Pexels auf Pixabay
Pexels auf Pixabay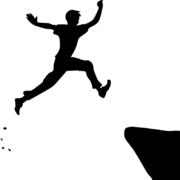 www.pixabay.com
www.pixabay.com  www.pixabay.com
www.pixabay.com Alexa | Pixabay
Alexa | Pixabay Miguel ángel villar auf Pixabay
Miguel ángel villar auf Pixabay Gerd Altmann auf Pixabay
Gerd Altmann auf Pixabay GiniGeo | Pixabay
GiniGeo | Pixabay Miguel ángel villar auf Pixabay
Miguel ángel villar auf Pixabay Pfarre Hildegard Burjan | Erwin Gruber
Pfarre Hildegard Burjan | Erwin Gruber